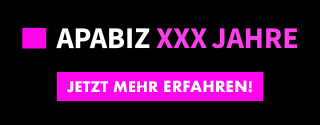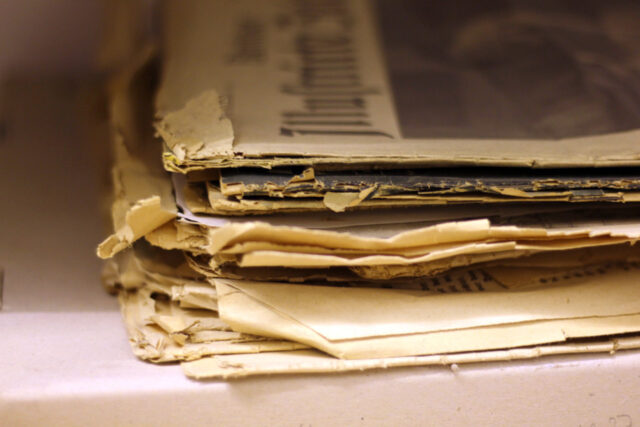
HassRedeFreiheit – Die Printmedien der nationalautoritären und extremen Rechten
Die nationalautoritäre und extreme Rechte kann auf ein vielschichtiges Publikationsangebot zurückblicken. Während sich ein Schwerpunkt des extrem rechten Medienhandelns in die digitale Öffentlichkeit verlagert hat, spielen Printprodukte weiterhin eine wichtige Rolle, um politische Orientierung anzubieten, Feindmarkierungen vorzunehmen und Identitäten zu formieren.
Von Fabian Virchow
In ihrer grundlegenden Studie zur Geschichte der extremen Rechten in der alten Bundesrepublik Deutschland haben Peter Dudek und Hans-Gerd Jaschke bereits 1984 gezeigt, dass das Überleben dieser politischen Strömung in Zeiten geringer parlamentarischer Präsenz sowie schwacher realer Einflussmöglichkeiten nicht zuletzt aufgrund einer Vielzahl an Medienangeboten möglich war[1]. Gemessen an der Bedeutung dieser vielfältigen und kleinteiligen Struktur, die allerdings auch gut sichtbare Ableger wie die Deutsche National-Zeitung hervorgebracht hat, die mit einer Auflage von über 100.000 Exemplaren zeitweise zu den auflagenstärksten Wochenzeitungen des Landes gehörte, ist das Publikationswesen der extremen Rechten in der Bundesrepublik Deutschland im Detail wenig erforscht; es liegen vor allem Arbeiten zu den Publikationen des DSZ-Verlages von Gerhard Frey[2] sowie zur Wochenzeitung Junge Freiheit vor[3].
Obgleich sich auch auf Seiten der extremen Rechten der Schwerpunkt des Medienhandelns in digitale Öffentlichkeiten verlagert hat, spielen Printprodukte noch immer eine wichtige Rolle, um politische Orientierung anzubieten, Feindmarkierungen vorzunehmen und Identitäten zu formieren. Vielfach verfügen diese auch über Angebote im virtuellen Raum.
Verfolgt man die Sichtweise der extremen Rechten auf die etablierte Medienlandschaft in Deutschland, so wird diese im Kern als feindlich gegenüber ›deutschen Interessen‹ dargestellt. Letztere werden dabei völkisch bestimmt, so dass insbesondere der Liberalismus und gesellschaftliche Vielfalt als zerstörerisch wahrgenommen werden. Berichterstattung, die beispielsweise die Pluralisierung sexuellen Begehrens abbildet oder Einwanderung nicht dezidiert als bio- und sicherheitspolitische Bedrohung darstellt, wird als Gefahr für den Fortbestand des ›deutschen Volkes‹ angesehen und daher scharf angegriffen. Schon die nach der Befreiung vom Nationalsozialismus einige Jahre praktizierte Lizensierung von Zeitungen und Zeitschriften durch die Alliierten, mit der eine demokratische Pressevielfalt sichergestellt werden sollte, wurde als unbotmäßiger Eingriff in die ›deutsche Souveränität‹ angesehen und die entsprechend lizensierten Medien als ›Lizenzpresse‹ geschmäht[4]. Seit Mitte der 2010er Jahre hat der Begriff der ›Lügenpresse‹ weite Verbreitung gefunden.
Als Ausdruck eines eingeengten Sagbarkeitsraums sieht die extreme Rechte bis heute auch strafrechtliche Regelungen an, insbesondere den Paragraphen 130 Strafgesetzbuch, in dem Volksverhetzungstatbestände geregelt sind. Nicht zufällig gab es beim jüngsten AfD-Parteitag in Riesa im Januar 2025 auch den Antrag, die entsprechenden Paragraphen quasi abzuschaffen – Redefreiheit soll völlig frei und Hassrede unsanktioniert sein: Hassredefreiheit eben[5].
Mit ihrer Metapolitik von rechts zielt die extreme Rechte darauf ab, Kultur und Sprache mit rassistischen, nationalistischen und antifeministischen Denkfiguren und Ideologemen zu durchdringen und gemeinhin positiv besetzte Begriffe wie beispielsweise Freiheit mit dem eigenen politischen Referenzsystem zu verbinden. Zu den entsprechenden Strategien zählt auch die Etablierung eigener Medienprodukte, um mittels einer solchen Gegenöffentlichkeit nicht nur die bereits existierende Anhängerschaft zu erreichen, sondern auch neue Zielgruppen anzusprechen.
Die nationalautoritäre und extreme Rechte kann auf ein vielschichtiges Publikationsangebot zurückblicken; neben organisationsinternen Zirkularen und Rundbriefen für das eigene Umfeld gibt es bis heute ein breites Spektrum an Veröffentlichungen, die spezifische Themen bedienen oder ein Publikum außerhalb der eigenen Stammkultur ansprechen sollen. Manche Publikationen erscheinen in geringer Auflage und dienen eher der Selbstvergewisserung, andere verzeichnen eine größere Reichweite, wie etwa die inzwischen mehrere Jahrzehnte erscheinende Junge Freiheit.
Angesichts der Vielzahl zum Teil auch miteinander konkurrierender extrem rechter und nationalautoritärer Weltanschauungen sowie der Unterschiede hinsichtlich der Zielgruppen und kommunikativen Ansätze kann es nicht verwundern, dass es nicht das eine zentrale Medienprodukt gibt. Die Spannbreite reicht von Quartalszeitschriften wie N.S. Heute, die der neonazistischen Szene verbunden ist, über parteinahe Projekte wie die Deutsche Stimme und die von AfD-Gliederungen herausgegebenen Blätter bis hin zu Monatszeitschriften wie Tichy’s Einblick, die als national-marktradikal gelten können. Das seit über fünfzehn Jahre erscheinende Monatsblatt ZUERST! ist zu einem Propagandablatt der AfD geworden. Alle diese Zeitschriften zielen darauf ab, die Zustimmung für ein Parteiprojekt rechts von der CDU/CSU zu stärken.
Während Junge Freiheit und ZUERST! aufgrund ihrer weiten Verbreitung und der Orientierung an aktuellen politischen Entwicklungen (z.B. Wahlen; Gesetzgebung) stark auch auf die Ansprache von Gelegenheitskäufer*innen zielen, geht es anderen Zeitschriften wie CATO oder Tumult, die alle zwei bzw. drei Monate erscheinen, eher um die weltanschauliche Ausrichtung unter Rückgriff auf philosophische und religiöse Perspektiven. Dementsprechend sind sie auch sprachlich anspruchsvoller und gestalterisch eher gediegen. Zeitschriften wie Compact oder Sezession dienen mit ihren polarisierenden Die-Wir-Darstellungen nicht nur der Stabilisierung des Milieus, sondern treten immer wieder mit Vorschlägen für konkrete politische Interventionen an extrem rechte und verschwörungsideologische Milieus heran[6].
Das vielfältige publizistische Angebot nationalkonservativer und extrem rechter Akteur*innen weist signifikante Überschneidungen in zentralen Narrativen zu Zustand und Entwicklungsrichtung der gesellschaftlichen und politischen Lage auf. Dabei stehen insbesondere dystopische Auslegungen einer menschenrechtsorientierten liberalen Asyl- und Migrationspolitik, die Vervielfältigung der Geschlechter- und Familienkonzepte, die Sichtbarkeit religiöser Vielfalt, Klimagerechtigkeit sowie produktivistische Perspektiven im Mittelpunkt. Die eigene Position und Handlungsspielräume werden als bedroht durch eine linke woke Hegemonie angesehen.
In unterschiedlicher Dichte und Hermetik wird auf eine zentrale Steuerung dieser Entwicklung abgehoben; besonders relevant sind entsprechende Verschwörungsideologien bei Compact, wo sie auch stark antisemitisch konnotiert sind. Die Vorstellung einer wirkmächtigen Allianz aus (öffentlich-rechtlichen) Medien, Regierung und zivilgesellschaftlichen Lobbygruppen (z.B. zu geschlechtlicher Vielfalt) ist weit verbreitet. Differenzen gibt es programmatisch etwa mit Blick auf die Zentralität völkischer Weltdeutung, die Bewertung globaler Mächte als Widersacher oder mögliche Verbündete (USA, Russland, China), aber auch hinsichtlich der Reichweite der Veränderungswünsche und der als wirksam erachteten Wege, diese zu erreichen. Nicht zuletzt hat auch die Bestimmung des Zielpublikums Einfluss auf die Art der Präsentation der jeweiligen Weltdeutung.
Anfang der 1990er Jahre bilanzierte Astrid Lange ihren Überblick über die extrem rechte Publizistik in Deutschland: »Faktisch ersetzen sie die Großpartei. Sie fungieren als organisatorische Klammer, als Koordinations- und Betreuungsinstanz. Sie gewährleisten einen regelmäßigen und dauerhaften Informationsfluß. (…) Darüber hinaus schulen Periodika ihre Leser. In allen Blättern werden historische Vorbilder und deren Ideen, gängige bzw. für die Gruppierung charakteristische Themen behandelt.«[7] Während die Funktionen geblieben sind, hat sich doch geändert, dass es mit der AfD inzwischen eine extrem rechte Großpartei gibt, die nicht nur professionelle Öffentlichkeitsarbeit betreibt, sondern zudem mit den digitalen Medien über eine sehr große Reichweite verfügt, und um die sich zahlreiche sympathisierende Medien versammelt haben. Die Vielzahl der Printprodukte, von denen sich in den letzten fünfzehn Jahren mehrere am Markt etabliert haben, zeigt zugleich, dass es auch hierfür eine Nachfrage gibt. Diese wird inzwischen professionell bedient – nicht zuletzt durch berufserfahrene Journalist*innen, die in solche Medien gewechselt sind.
- ↑ Dudek, Peter/Jaschke, Hans-Gerd 1984. Entstehung und Entwicklung des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- ↑ Reinecke, Karsten 1970. Die ›Deutsche National-Zeitung und Soldaten-Zeitung‹, ein Organ der ›heimatlosen Rechten‹ in der Bundesrepublik. Dissertation vom 24.07.1970, Universität Erlangen-Nürnberg; Dudek, Peter/Jaschke, Hans-Gerd 1981. Die Deutsche National-Zeitung: Inhalte, Geschichte, Aktionen. München: Pressedienst Demokratische Initiative.
- ↑ Klein, Ludger 2003. Rechtsextremismus und kollektive Identität. Eine sozialpsychologische Studie über ›Die Republikaner‹ und die ›Junge Freiheit‹. Dissertation vom 08.05.2003, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel; Dietzsch, Martin/Jäger, Siegfried/Kellershohn, Helmut/Schobert, Alfred (Hg.) 2004. Nation statt Demokratie. Sein und Design der ›Jungen Freiheit‹. Münster: Edition DISS; Meyer, Christian 2013. Das Feindbild der ›multikulturellen Gesellschaft‹ in der ›Jungen Freiheit‹ und der ›Nation und Europa‹. Dissertation vom 23.04.2015, FU Berlin.
- ↑ Virchow, Fabian 2017: Medien als ›Agenturen der Dekadenz‹ und als Kampfplatz für ›deutsche Interessen‹. In: Christoph Kopke/Wolfgang Kühnel (Hg.): Demokratie, Freiheit und Sicherheit. Baden-Baden: Nomos, S. 221-238.
- ↑ Brühl, Jannis 2025. Hassredefreiheit. In: Süddeutsche Zeitung 09.01.2025, S. 16.
- ↑ Virchow, Fabian 2025. Getrennt publizieren – vereint erzählen!? Metapolitische Erzählungen rechts außen. In: Fabian Kaufmann/Lena Sierts (Hg.): Medienpädagogische Interventionen im Feld der Neuen Rechten. Theoriebasierte Analysen, praktische Methoden und Reflexionen. Toronto/Opladen: Barbara Budrich, S. 87-107.
- ↑ Lange, Astrid 1993. Was die Rechten lesen. Fünfzig rechtsextreme Zeitschriften. Ziele, Inhalte, Taktik. München: Verlag C.H.Beck.