Wenn Männer Frauen* töten, weil sie Frauen* sind
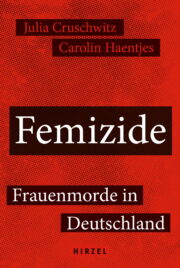
Rezension: Julia Cruschwitz / Carolin Haentjes: Femizide. Frauenmorde in Deutschland, S. Hirzel Verlag 2022, 216 Seiten, 18 €.
Von Kilian Behrens
2020 wurden in Deutschland 139 Frauen* von ihren (Ex-)Partnern getötet. Statistisch bedeutet dies jeden dritten Tag einen Mord. Die Anzahl der Tötungsversuche liegt mit einem alle zwei Tage noch höher. Dennoch werden Morde an Frauen* weiterhin regelmäßig als »Familien-« oder »Eifersuchtsdramen« verharmlost, entpolitisiert und den Opfern eine Mitschuld unterstellt. Die Journalistinnen Julia Cruschwitz und Carolin Haentjes zeigen in ihrem Buch eindrücklich das Ausmaß von Beziehungstötungen in Deutschland auf. Dabei handelt es sich um ein gesamtgesellschaftliches Problem, zu dessen Lösung sie mehr politischen Willen einfordern.
Das Wort Femizid bezeichnet die Tötung von Frauen*, weil sie Frauen* sind. Hintergrund sind patriarchale Machtverhältnisse und ein Besitzdenken von Männern über Frauen* und ihr Leben. Eine entsprechende juristische Definition fehlt in Deutschland bislang. Insgesamt ist der Begriff sehr breit, was teilweise zu Kritik führt, und umfasst u.a. auch Morde an Frauen* und Mädchen* in Namen von »Ehre«, deren gezielte Tötung in Kriegen oder im Rahmen von organisierter Kriminalität sowie aufgrund von Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung. Die Autorinnen widmen sich der in Deutschland häufigsten Form, den Trennungstötungen. Mehr als die Hälfte der hierzulande getöteten Frauen* hatte zuvor eine partnerschaftliche Beziehung zum Tatverdächtigen. Die Autorinnen fordern ein stärkeres Problembewusstsein und politischen Gestaltungswillen, um an dieser Situation etwas zu ändern. Dafür sei der Begriff gut geeignet. Er bedeute »eine Haltung einzunehmen, die […] eigentlich selbstverständlich sein sollte: Frauen haben grundsätzlich ein Recht darauf, selbst über ihr Leben zu entscheiden[.]« (S. 15)
Wie Femizide deutlich besser verhindert werden könnten, legen die Autorinnen ebenfalls dar. Häufig fehle es auf behördlicher Ebene an Kenntnissen geschlechtsspezifischer Gewalt. Dabei existieren Werkzeuge zur Femizid-Prävention und Gefahreneinschätzung wie der »Ontario-Domestic-Assault-Risk-Assessment«-Fragebogen (ODARA) bereits seit Ende der 1990er-Jahre. Doch selbst wenn Informationen über eine gewalttätige Vergangenheit der Täter vorliegen, tauschen die beteiligten Stellen diese oft nicht untereinander aus. Lediglich ein Viertel der Bundesländer verfügt aktuell über ein systematisiertes Hochrisikomanagement, so die Recherche.
Positiv bewerteten die Autorinnen das Modell in Rheinland-Pfalz. Hier müssen Beamt*innen nach entsprechenden Einsätzen verpflichtend den ODARA-Fragenkatalog beantworten. Ab einer gewissen Punktzahl wird von Hochrisikofällen gesprochen. In der Folge kommt es zu Konferenzen aller beteiligten Stellen (z.B. Polizei, Jugendamt, Sozialpsychatrischer Dienst), häufig unter Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Organisationen wie etwa Frauen*beratungsstellen. Auch diese können Treffen einberufen, selbst wenn es (noch) nicht zu einer Straftat kam. Das System stellt sicher, dass Expertisen zusammengeführt werden, um die Gefährdungslage umfassend einschätzen zu können.
Als weiteres drängendes Problem beschreibt das Buch die chronische Unterfinanzierung von Frauenhäusern. Bei der Menge der angebotenen Plätze werden internationale Standards unterlaufen, wie sie in der Istanbul-Konvention festgelegt sind. In der Regel sind die Anlaufstellen überfüllt oder kilometerweit entfernt. Für geflüchtete Frauen* brauche es spezielle Hilfsangebote. Teil der Präventionsmaßnahmen sollte zudem die Täterarbeit sein, denn ohne Umdenken werden diese nach abgeleisteter Strafe sehr wahrscheinlich erneut gewalttätig.
Im Familienrecht weisen die Autorinnen ebenfalls auf Handlungsbedarf hin. So stehe bei Umgangsverfahren seitens der Gerichte meist eine gütliche Einigung im Fokus. Dies gehe jedoch häufig zu Lasten des Gewaltschutzes von Müttern* und Kindern, wie die Journalistinnen zeigen. Durch die erlebte Gewalt werden Kinder ebenfalls stark traumatisiert und bisweilen selbst zu Mordopfern, weil die in ihrem patriarchalen Besitzdenken verhafteten Täter so ihre Ex-Partnerin* bestrafen wollen.
Die Stärke des Buchs besteht darin, dass es die Perspektiven von Überlebenden, Zeug*innen und Angehörigen sowie Wissenschaftler*innen, Polizist*innen, Anwält*innen aber auch Aktivist*innen zusammenbringt. Cruschwitz und Haentjes geben den Leser*innen einen gut strukturierten Überblick der verschiedenen Ebenen an die Hand, auf denen es anzusetzen gilt. Das Buch ist ein wichtiger Beitrag zu einer drängenden Debatte. Diese braucht deutlich mehr Aufmerksamkeit, nicht zuletzt auch von Männern, die das Thema noch viel zu oft ignorieren.


